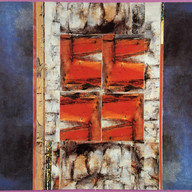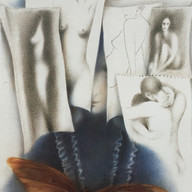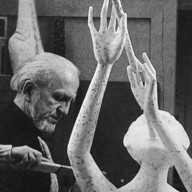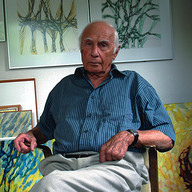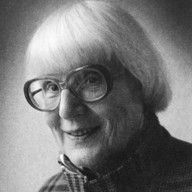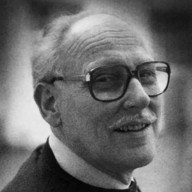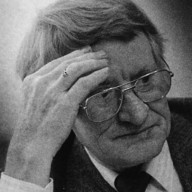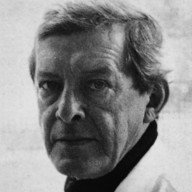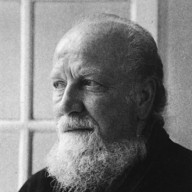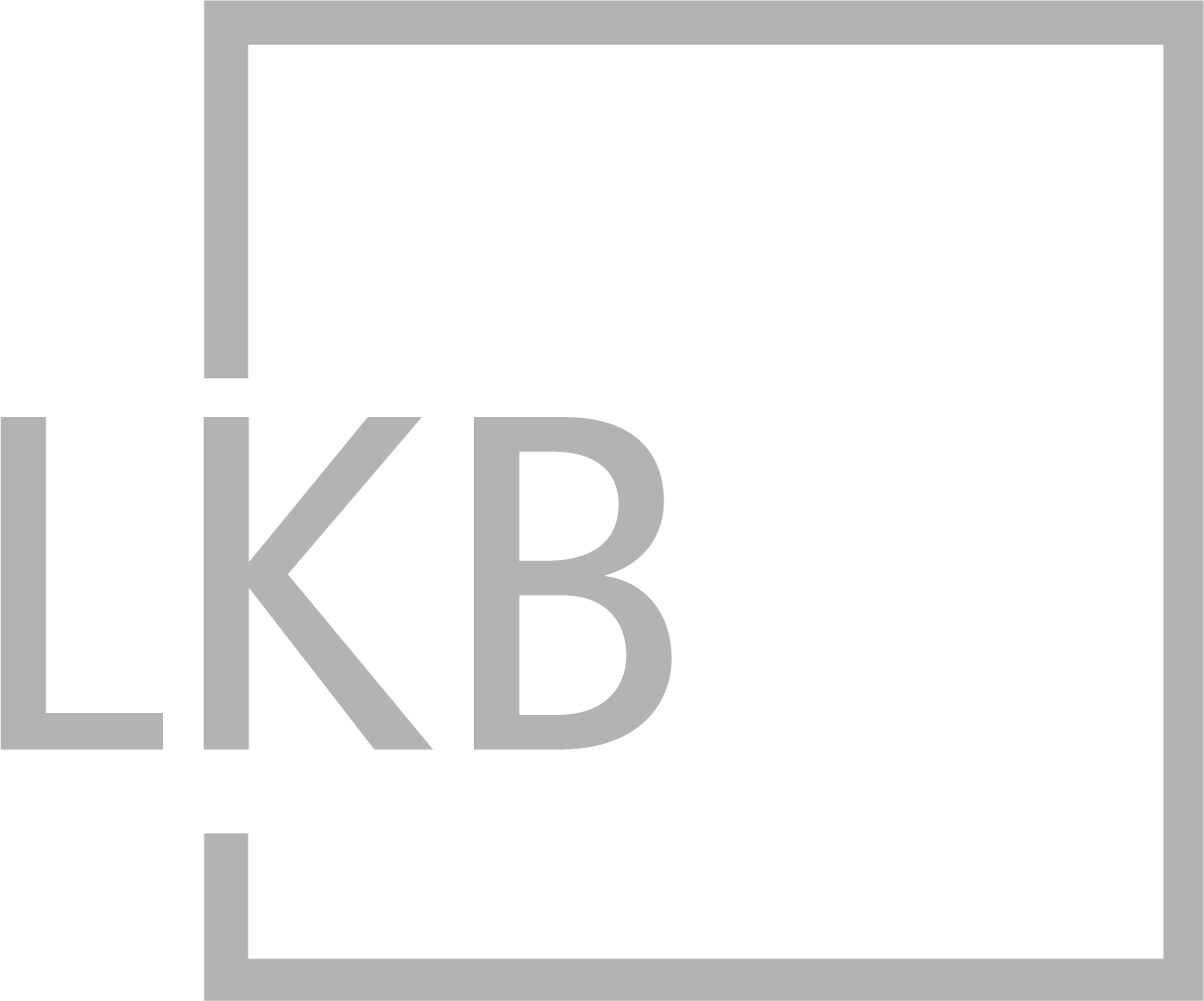Steinecke, Walter
Der Hauptmann a.D. Walter Steinecke (1888-1975) war Kunstmaler, Verleger und Mitglied der NSDAP.
Die Anfragen der lippischen Künstlerinnen und Künstler an die lippische Landesregierung nach Aufträgen und Ausstellungsmöglichkeiten in der vom Lippischen Künstlerbund betreuten Lippischen Kunsthalle wurden zum Ende der 1920er Jahre ausschließlich über den LKB organisiert und geregelt. Hier kamen sich der Vorstand des LKB und der Kunstmaler und Verleger Steinecke aus Lemgo immer wieder in die Quere. Nach vergeblichem Bemühen, in der Kunsthalle auszustellen, fand Steinecke im November 1929 im Hotel Stadt Frankfurt in Detmold eine Austellmöglichkeit, wo er 100 lippische Motive zum Thema „Heimat“ präsentierte.
1930 trat er in den LKB ein.
Steinecke löste im Oktober 1932 Dr. Fuhrmann als Bezirksleiter des NSDAP-Bezirks Lippe ab. Nach der Neuorganisation der Partei erhielt er als sog. „Landesleiter“ eine nicht näher definierte, im Organisationsschema der NSDAP eigentlich nicht vorgesehene und wohl an die damaligen lippischen Verhältnisse angepaßte Aufsichtsrolle. In dieser Position organisierte er den Landtagswahlkampf, der im Januar 1933 zum Erfolg der NSDAP in Lippe führte. Steineckes war für geregelte Parteiarbeit ebenso wenig geeignet wie für die kontinuierliche Arbeit in einer Behörde, wie zum Beispiel dem Arbeitsamt in Detmold, dem er 1933 kurzzeitig vorstand.
Steinecke wurde Vorsitzender der neu eingerichteten lippischen Kulturkammer. In seiner Eigenschaft als Leiter des Arbeitsamtes löste er 1933 den Lippischen Künstlerbund auf. Karl Henckel, der Vorsitzende des LKB, bemühte sich im Sinne des Vereins und seiner ihm angeschlossenen Mitglieder, weiter wirken zu können. Er bewarb sich für den Stellvertreterposten in der lippischen Untergruppierung der Reichskammer der bildenden Künste, der ihm auch übertragen wurde.
Nach Abschaffung des Reichsverbands der Bildenden Künste durch die Nationalsozialisten bestand die einzige Möglichkeit, dem Künstler-Beruf nachzugehen, wenn man der neu gegründeten Reichskammer der Bildenden Künste beitrat.
Im August 1938 zeigt Walter Steinecke anlässlich des Kreistreffens der NSDAP in Lemgo seine Arbeiten, im Mai 1943 im Städtischen Kunsthaus Bielefeld Pflanzen und Tiere.
Im April 1945 wurde Walter Steinecke inhaftiert und in das Internierungslager Staumühle gebracht. Während seiner Haft bis 1947 entstanden rund 600 Zeichnungen und Gemälde.
Er lebte bis zu seinem Tod im Jahr 1975 in Hiddesen. Ohne auf seine Vergangenheit während des Nationalsozialismus einzugehen, wurden seine Arbeiten in mehreren Ausstellungen gezeigt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Steinecke
https://www.ecosia.org/images?q=Walter%20Steinecke